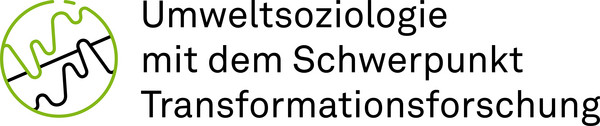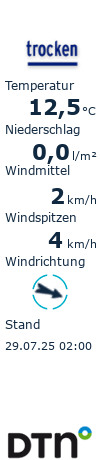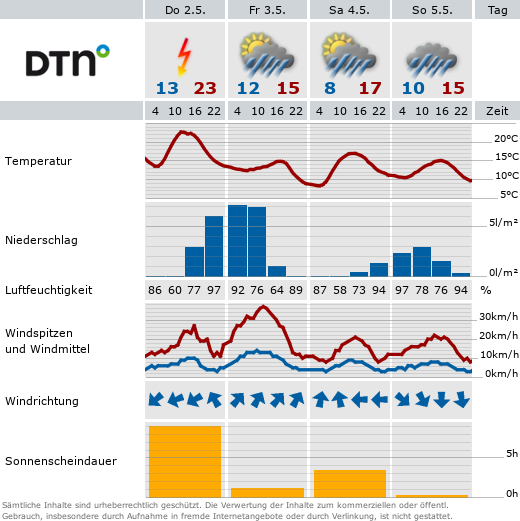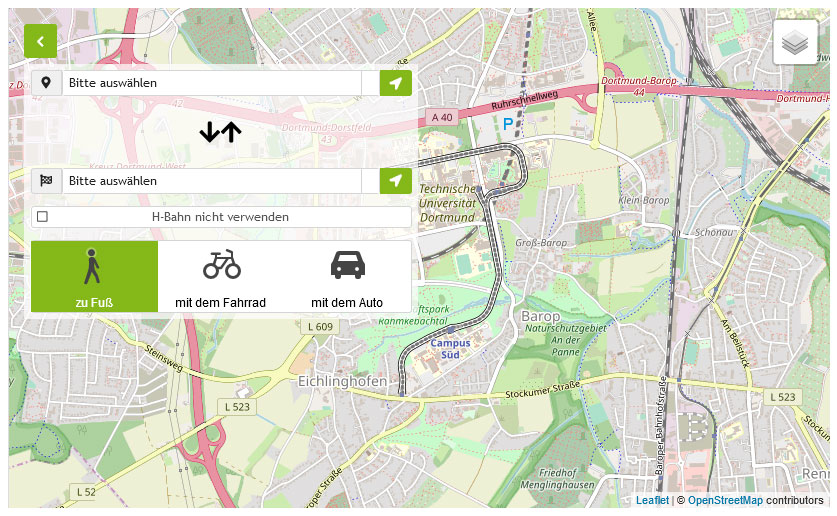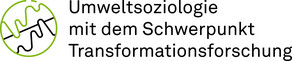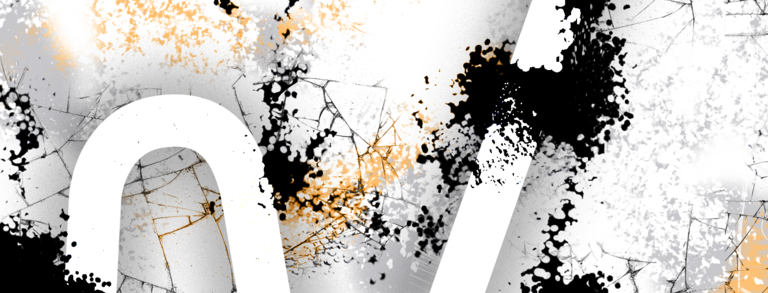Dissertationsprojekte
Klimaaktivismus hat bisher wenig Beachtung in Forschungsarbeiten zum Konsumverhalten junger Menschen gefunden. Mein Forschungsschwerpunkt liegt auf Praktiken ökologischer Nachhaltigkeit, insbesondere auf
Suffizienz- und Konsistenzstrategien. Suffizienzstrategien umfassen das Ausweichen auf umweltfreundliche Alternativen, wie beispielsweise Tauschen, Leihen oder Second-Hand-Käufe, sowie die Vermeidung von Konsum. Konsistenzstrategien im Bereich des nachhaltigen Konsums zielen auf den Kauf langlebiger und umweltfreundlicher Produkte, wie beispielsweise Bio-Lebensmittel. Ich lege meinen Fokus auf junge Menschen, da sie in ihren Konsumpraktiken noch weniger gefestigt bzw.
routiniert sind als ältere. Die Promotion zielt darauf ab, nachhaltigen Konsum als soziale Praxis im Kontext des Engagements junger Menschen in Klimagerechtigkeitsbewegungen zu untersuchen. Hierfür habe ich im Rahmen des Forschungsprojektes „Trans4mation-Fridays for Future“ an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen Interviews mit jungen Menschen mit unterschiedlich starkem Bezug zu „Fridays for Future“ geführt und an der Umsetzung einer repräsentativen quantitativen Studie mitgewirkt, in der junge Menschen in Italien, Großbritannien, Japan und Deutschland zu nachhaltigem Konsumverhalten, ihrem Blick auf das gesellschaftliche Naturverhältnis und ihrer Einstellung zu Kapitalismus befragt wurden.
Meine bisherigen Analysen legen nahe, dass Jugendliche, die sich in der Klimagerechtigkeitsbewegung engagieren, sich auch stark mit alternativen Konsumpraktiken auseinandersetzen und Konsumverzicht üben, obwohl sie eine Lösung der Klimakrise durch individuelle Anstrengungen wie politischen Konsum zumeist ablehnen und für nicht umsetzbar halten. Dies unterscheidet sie deutlich von anderen Jugendlichen, die nachhaltige Konsumpraktiken für relevanter bei der Lösung der Klimakatastrophe halten, umgekehrt aber, solche Praktiken aber seltener anwenden als die Aktivisti. Meine Promotion beschäftigt sich mit soziologischen Erklärungsansätzen für dieses Phänomen und greift dabei insbesondere auf die theoretischen Ansätze von Pierre Bourdieu und Norbert Elias zurück.
Fleisch galt lange als Symbol für Fortschritt und Wohlstand, doch aktuelle Perspektiven auf das Lebensmittel umfassen auch kritische Positionen: Fleischproduktion wird als umweltschädlich eingeschätzt, das Lebensmittel wird mit ernährungsbedingten Erkrankungen in Verbindung gebracht und die Ethik der Tierhaltung von Tierrechtsbewegungen infrage gestellt. Diese Neubewertung des Lebensmittels Fleisch und seiner Produktionsbedingungen hat auch Auswirkungen auf den Beruf des Metzgers, der sich in einer Phase des tiefgreifenden Wandels befindet und Gegenstand der angestrebten Promotion ist.
Der Fokus der Forschungsarbeit liegt auf der wechselseitigen Beziehung zwischen Geschlecht, Beruf und dem Lebensmittel Fleisch. Durch eine theoriegeleitete Analyse historischer Entwicklungen und empirischer Daten wird aufgezeigt, wie Berufsidentität und Männlichkeit im Metzgerhandwerk konstruiert werden und wie diese Konstruktionen mit gesellschaftlichen Veränderungen, wie dem Rückgang von Fleischereibetrieben und dem Aufstieg alternativer Ernährungsstile, verwoben sind.
Ausgehend von qualitativen Forschungsansätzen, darunter ethnographischen Beobachtungen und Leitfadeninterviews mit Metzger*innen, werden die sozialen und kulturellen Dynamiken im Metzgereihandwerk nachgezeichnet. Dabei werden insbesondere die Strategien von Metzger*innen in den Blick genommen, die den strukturellen Wandel und die Kritik an Fleischproduktion navigieren. Es wird argumentiert, dass der Beruf des Metzgers durch eine spezifische „Handwerker-Männlichkeit“ geprägt ist, die soziale Anerkennung über handwerkliches Können und Expertise generiert. Zugleich wird die ambivalente Beziehung zu Tieren als zentraler Bestandteil der Berufsidentität analysiert, die sich im Spannungsfeld zwischen Respekt für das Lebewesen und der ökonomischen Nutzung als Ressource bewegt. Die theoretischen Überlegungen der Arbeit stützen sich unter anderem auf Konzepte der hegemonialen Männlichkeit nach Raewyn Connell und des sozialen Raums nach Pierre Bourdieu.
Désirée Janowsky ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Shaping Future Society (SaFe): The Mutual Constitution of Future-Oriented Practices and Community“ an der Hochschule Fulda.
Kontakt:
Hochschule Fulda
Gebäude 35, Raum 102
Leipziger Straße 123
36037 Fulda
desiree.janowsky@oe.hs-fulda.de
Abgeschlossene Dissertationsprojekte
Trotz wachsender medialer Aufmerksamkeit, unzähligen politischen Zielvereinbarungen und massiven Investitionen in erneuerbare Energien und andere klimaschonende Technologien schreiten die großen sozial-ökologischen Krisen nahezu ungebremst voran. Immer deutlicher wird sichtbar, dass die bisherigen Anstrengungen, welche vor allem auf technische Lösungen fokussierten, nicht ausreichen und es einer tiefergreifenderen sozial-ökologischen Transformation bedürfte. Zunehmend wir die Nachhaltigkeitsstrategie der Suffizienz in wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Debatten als relevanter und bislang weitestgehend vernachlässigter Baustein einer sozial-ökologischen Transformation beschrieben. Suffizienz ist eine Strategie zur absoluten Reduktion von Konsum- und Produktionsniveaus - bei gleichzeitiger Sicherung eines Mindeststandards - durch Veränderungen von sozialen Praktiken und entsprechender politischer Rahmenbedingungen. Daher wird die Suffizienzstrategie von Kritiker*innen auch als „Verzicht“ diskreditiert und gilt in einer auf Wachstum gepolten Gesellschaft als politisch heikel.
Um einen Beitrag zu einer kritischen Reflexion über die Potentiale der Suffizienzstrategie zu leisten, befasst sich die angestrebte Promotion mit den Umsetzungsprozessen und Wirkungen von Suffizienzpolitik. Dabei liegt der Fokus auf Suffizienzpolitik, da davon ausgegangen wird, dass eine Reduktion von Produktions- und Konsumniveaus sowie eine Veränderung sozialer Praktiken ohne kulturelle, infrastrukturelle und institutionelle Veränderungen nicht möglich ist. Grob gliedert sich die Arbeit in vier Teile. Am Anfang stehen konzeptionelle Arbeiten zum Begriff der Suffizienz. Der Zweite Teil befasst sich mit Fragen der Legitimation und Anschlussfähigkeit von Suffizienz. Im dritten Teil stehen Umsetzungsprozesse von konkreten suffizienzepolitischen Maßnahmen auf kommunaler Ebene im Fokus und werden insbesondere mit Blick auf die entstehenden Konflikte und der von den Verwaltungen gewählten Vorgehensweisen untersucht. Im vierten Teil der Arbeit werden suffizienzpolitischen Maßnahmen in Bezug auf ihre ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Wirkungen evaluiert.
Jonas Lage ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Nobert Elias Center for Transformation Design and Research an der Europa-Universität Flensburg und promoviert im Rahmen der BMBF-Nachwuchsforschungsgruppe „Die Rolle von Energiesuffizienz in Energiewende und Gesellschaft (EnSu)“. Darüber hinaus ist Jonas Lage als Teil des I.L.A.-Kollektivs als Bildungsreferent und Autor tätig.
Kontakt:
Europa-Universität Flensburg
Auf dem Campus 1
Gebäude TALLINN 1, Raum 306
24943 Flensburg
+49 (0) 461-805-2657